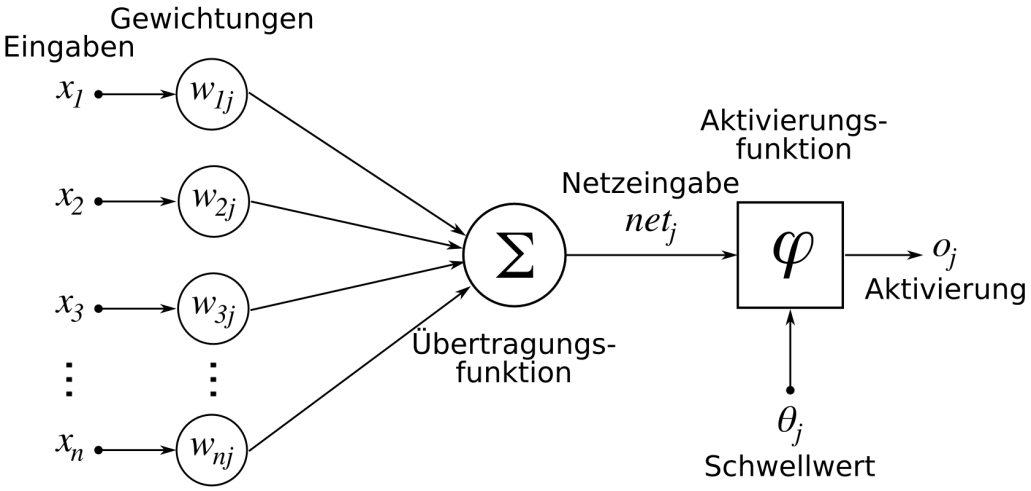Von allen Formen des Unmoralischen darf der Neid als eine der komplexesten gelten. Das Phänomen ist nicht schon dadurch charakterisiert, dass eine Person A gerne so wäre wie eine Person B oder gerne ein Gut C – sei es ein Wert, ein Gegenstand, eine Eigenschaft oder eine Fähigkeit – der Person B hätte, das sie selbst nicht besitzt. Vielmehr ist Neid mit einem Unlust- oder Schmerzgefühl für Person A verbunden, die sich hinsichtlich C mit B vergleicht und ihren Mangel als ungerechtfertigt und empörend empfindet. Aristoteles hat dies folgendermaßen beschrieben: „Ein leidenschaftliches Unlustgefühl ist nämlich allerdings auch der Neid, und zwar bezieht auch er sich auf das Glück eines anderen, aber nicht auf das eines Unwürdigen, sondern auf das eines, der nach Berechtigung und Stellung im Leben unsers Gleichen ist.“ (Rhetorik, 1386b). Immanuel Kant bestimmt den Neid als „Hang das Wohl Anderer mit Schmerz wahrzunehmen, obzwar dem seinigen dadurch kein Abbruch geschieht“ (Metaphysik der Sitten, AA VI, 458). Neid kann nur in einem Raum oder Kontext auftreten, den Rousseau als „Vernunftzustand“ dem „Naturzustand“ entgegengesetzt hatte. Während im Naturzustand die Menschen durch eine gesunde Selbstliebe und das Mitleid miteinander harmonieren, so tendieren Sie durch die Vernunft dazu, sich mit anderen zu vergleichen. Räume und Kontexte des Neides sind Konkurrenzsituationen, offensichtliche Werte und Stärken, normative Kontexte wie Schulen und wertorientierte Kontexte wie das Finanzgewerbe. Der Neid scheint eine bestimmte Form der Entwicklung eines Menschen vorauszusetzen, auch wenn er sich bereits im Phänomen des „Futterneides“ bei Tieren findet, wenn sie sich ungleich behandelt fühlen und in der Folge nicht mehr kooperieren. Es stellt sich jedoch die Frage, ob man Tiere um etwas beneiden kann. Hier scheint die notwendige Vergleichsebene zu fehlen, die im Neid vorausgesetzt wird.
Im missgünstigen Neid wird das Gut des anderen als Grund oder Anlass des eigenen Schmerzes verstanden, der aus dem unterlegenen Vergleich resultiert. Eine naheliegende Reaktion auf diesen Schmerz oder die Kränkung besteht dann darin, diesen Grund zu beseitigen. Mehr noch: Die andere Person wird für den eigenen Schmerz verantwortlich gemacht und ist nicht selten überrascht von dieser Argumentation des Neiders. Dies ist freilich ein Fehlschluss, der dem Neider jedoch nicht bewusst ist. Hier stellt sich die Frage, ob Neid nur dann auftritt, wenn eine andere Person einen Vorzug verdientermaßen besitzt, oder auch dann, wenn sie sich diesen ungerechterweise zugeignet hat. Für die Struktur des Neides als Missgunst ist es jedoch wesentlich, das Gut C der Person abzusprechen, insofern es ihr nicht gerechterweise gebührt, sondern, wenn schon, dann einem selbst. Es stellt sich ferner die Frage, ob Neid ein Gefühl oder eine Haltung ist. Ohne Frage ist Neid phänomenal durch eine gewisse emotionale Tönung charakterisiert, die etwa dann beschrieben wird, wenn man davon spricht, dass eine Person „grün“ oder „gelb“ vor Neid ist. Damit ist im Unterschied zur Farbe Rot gemeint, dass Neid nicht energisch nach Außen sich entlädt, sondern sich im Zerknirschen, im Gram oder Selbstmitleid der neidischen Person innerlich manifestiert.
Der Neid kann durch ein Paradox charakterisiert werden, dass darin besteht, dass der Neider als solcher nicht weiß, dass er neidisch ist, und dass er kein Neider mehr ist, sofern er weiß, dass er neidisch ist. Dieses Paradox des Neides kann durch folgende Sätze semantisch und pragmatisch näher bestimmt werden
(1) A beneidet B wegen/um C.
Dieser Satz lässt sich folgendermaßen weiter analysieren:
(2) A ist der Meinung, dass B nicht C verdient (oder nur/auch A C verdient) wegen D.
Bei D handelt es sich um eine Rechtfertigung und Argumentation, die die vermeintlich eigene ungerechte Stellung gegenüber B weiter begründet.
(3) A weiß, dass sie B wegen/um C beneidet.
(4) A sagt zu B: „Ich beneide Dich wegen/um C“
Das Element D scheint für den missgünstigen Neid elementar zu sein. Entscheidend ist, dass die Person A im Falle von D sich nicht bewusst ist, dass sie neidisch ist, sondern glaubt, dass sie zurecht das Fehlen von C beklagt oder aber Bs Besitzen von C in Frage stellt. A will sich durch D nicht eingestehen, dass sie im Grunde B den Wert C gönnen sollte, da er durchaus verdient sein könnte, selbst dann, wenn man ihn auch verdient hätte. A unterliegt also in D einer Art selbstverschuldeten Selbsttäuschung.
Man kann nun fragen, inwiefern der Satz (3) den Satz (2) oder (1) impliziert. Es scheint, dass (3) mit (2) und (1) inkompatibel ist. Denn im Wissen um den eigenen Neid scheint gerade das Element D ausgeschlossen zu werden. Offensichtlich wird dies im Fall von Satz (4), aus dem klar die Falschheit von (2) und (1) zu folgen scheint. Wer einem anderen sagt, dass er ihn wegen etwas beneide, der wird als sympathisch wahrgenommen, weil sein offenkundiger Neid weniger eine verdeckte Missgunst als eine offene Anerkennung darstellt. Wer sagt, dass er neidisch sei, ist dadurch performativ gerade nicht mehr neidisch.